Aktuelles
Zürich – Forschende der Universität Zürich (UZH) untersuchen biologische Ursachen und Wirkungen von Depressionen in der Schwangerschaft. Gesucht wird eine Behandlungsform, die das Wohlbefinden der werdenden Mütter bessert, ohne den Fötus zu schädigen.
Forschende der Universität Zürich (UZH) beteiligen sich an dem europäischen Projekt Happy Mums, das unter der Leitung der Universität Mailand geführt wird. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, nehmen von Seiten der UZH die Forschungsgruppen des Phamakologen Urs Meyer und der Pharmakologin Juliet Richetto sowie die Gruppe der Neuro-Epigenetikerin Isabel Mansuy teil. Insgesamt beteiligen sich an dem Horizon-Europe-Projekt 17 Universitäten und Organisationen.
Gegenstand der umfassenden Studie ist nicht nur, manifeste Depressionen von Stimmungsschwankungen in der Schwangerschaft unterscheiden zu können. Es sollen auch Behandlungsmethoden gefunden werden, die das Wohl depressiver werdender Mütter bessern, ohne dem werdenden Leben zu schaden. Bislang gibt es zu geringe Erkenntnisse darüber, wie sich Substanzen wie Antidepressiva auf den Fötus auswirken. Das Projekt Happy Mums soll dazu beitragen, biologische und mikrobiologische Prozesse, die in der Schwangerschaft ablaufen, ebenso zu erkunden wie psychische Prozesse während dieser Zeit.
„Damit wir diese komplexen Zusammenhänge aufdröseln können, kombinieren wir eine Vielzahl von Daten aus der klinischen und präklinischen Forschung“, wird Juliet Richetto, Pharmakologin an der UZH, in der Mitteilung zitiert.
Um eine grosse Datenmenge zu erhalten, begleitet Happy Mums tausend Mütter und Kinder während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Dabei werden vielzählige paraklinische Werte wie Blutwerte und Hormonspiegel ebenso erhoben wie genetische Daten. Bildgebende Verfahren ergänzen das Diagnosespektrum.
Das internationale Projekt läuft bis 2026. Von den Studienresultaten erhoffen sich die Forschenden, die psychische Gesundheit von Müttern und Kindern dauerhaft zu bessern. ce/eb

UZH-Forschendeuntersuchen biologische Ursachen und Wirkungen von Depressionen in der Schwangerschaft. Symbolbild: Cparks/Pixabay
Events
Jeder zweite Menschen erkrankt einmal in seinem Leben an einer psychischen Störung. In diesem Online-Austauschtreffen gehen wir den Fragen nach, wie psychische Erkrankungen frühzeitig erkannt werden und was HR-Fachpersonen und Führungskräfte tun können. Wir geben ausserdem Tipps für Gespräche mit betroffenen Mitarbeitenden. Im anschliessenden Austausch gibt es genügend Raum für konkrete Beispiele und Fragen aus der Praxis.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Sie wird vom Forum BGM Zürich durchgeführt.
Anmeldung: info@bgm-zh.ch

Aktuelles
Zürich/London – Will Lahaise und Chris Rowe haben die Personalberatung pltfrm gegründet. Der ehemalige Leiter von UBS Recruiting und der EMEA-Chef einer globalen Personalberatung wollen damit die Branche für die Vermittlung von Führungskräften aufrollen. Pltfrm setzt auch Künstliche Intelligenz ein.
Chris Rowe aus Zürich und Will Lahaise aus London haben eine Personalberatung der nächsten Generation gegründet. Ihr Unternehmen pltfrm soll die Branche für die Vermittlung von Führungskräften neu definieren. Dazu setzen der ehemalige EMEA-Chef einer globalen Executive Search Firma und der ehemalige Leiter von UBS Recruiting neben menschlichen Kenntnissen und Einschätzungen auch Künstliche Intelligenz ein.
„Mit dem Einsatz herkömmlicher Auswahlverfahren findet man konventionelle Führungskräfte“, wird Rowe in einer entsprechenden Mitteilung von pltfrm zitiert. Dieser Ansatz sei „für viele Unternehmen nicht mehr zeitgemäss“. Pltfrm baut in seine Auswahlverfahren eine quantitative Bewertung von Inclusive Leadership und Digital Mindset ein.
„Diversität ist heute entscheidend“, meint Rowe. „Interessanterweise waren die ersten vier globalen Führungskräfte, welche pltfrm vermittelt hat, alle weiblich.“ Für den Personalexperten stellt Inklusion den „Schlüssel zu nachhaltiger Diversität“ dar. Dabei reiche eine einzelne Führungskraft mit diversem Hintergrund nicht aus. „Wir helfen unseren Kunden, vorherzusagen, welcher Kandidat oder welche Kandidatin am besten geeignet ist, diverse Teams aufzubauen“, so Rowe.
Das Büro von pltfrm in Zürich wird von Rowe geleitet, der zweite Standort in London untersteht der Leitung von Lahaise. Der innovative Ansatz von pltfrm finde auch bei grossen Unternehmen Zustimmung, heisst es in der Mitteilung. Ihr zufolge bekommt pltfrm bereits zunehmend Mandate für C-Level-Positionen. ce/hs

Will Lahaise (links) und Chris Rowe, die Gründer von pltrm. Bild: zVg/pltfrm
Startups
Eine neue Windturbine
Agile Wind Power entwickelt die weltweit erste, vertikalachsige Windturbine, die wirtschaftlich interessant ist für die dezentrale Erzeugung für von erneuerbarem Strom. Auf Grund der Vorteile dieser vertikalachsigen Windturbine können Gebiete und Märkte bedient werden, die mit herkömmlichen Windturbinen auf Grund mangelnder Akzeptanz nicht realisiert werden können. Die ersten Produkte, A32 und A45 (Nennleistung von 750 Kilowatt und 1,5 Megawatt), sind ideal positioniert für die dezentrale Stromerzeugung, bei der geringere Umweltbelastungen von hoher Relevanz sind (Siedlungsgebiete). Die Technologie kann auch in noch größeren Windkraftanlagen eingesetzt werden.
Sonnentalstrasse 8 P.O. Box 232
8600 Dübendorf
Entwicklung einer Windturbine zur dezentralen Erzeugung von erneurbarem Strom.

Startups
daura ist der Marktführer für die Ausgabe und die Verwaltung von digitalen Beteiligungen (Aktien, Partizipationsscheine, Wandelanleihen) an nichtkotierten Unternehmen in der Schweiz. daura nutzt dazu die Blockchain-Technologie und stellt alle Funktionen über eine nutzerfreundliche und rechtssichere Plattform bereit. Zudem treibt daura die nahtlose Integration digitaler Assets in die bestehende Finanzmarktinfrastruktur der Schweiz voran (digitale Marktplätze und Banken).
Unternehmen vereinfachen durch die Nutzung der daura Plattform ihre Kapitalbeschaffung, Beteiligung von Mitarbeitern, Verwaltung von Aktionären (Generalversammlung, Aktienbuch) und die Platzierung Ihrer Unternehmensanteile an digitalen Marktplätzen.
daura ist ein Gemeinschaftsunternehmen von BDO, Berner Kantonalbank, SIX, Swisscom, Sygnum Bank, Luka Müller (MME) und Christian Wenger (Wenger&Vieli).
Konradstrasse 12
8005 Zürich
Blockchain, digitale Assets, Kapitalbeschaffung, Ökosystem, Startups, KMUs, Marktplatz

Finanzierungsunterstützung
Lendity ist ein preisgekröntes Schweizer Unternehmen, das sich auf technologiegestützte Privatkredite spezialisiert hat. Unser Geschäftsschwerpunkt ist die Bereitstellung innovativer Kapitallösungen für den Schweizer Markt, wobei wir die neuesten Technologien einsetzen. Wir sind in mehreren vertikalen Bereichen tätig, weil wir davon überzeugt sind, dass wir das richtige Kapital zur richtigen Zeit für den richtigen Zweck einsetzen.
Lendity ist aus Tenity hervorgegangen, einem globalen Innovations-Ökosystem und Frühphaseninvestor, der die Zukunft des Finanzwesens vorantreibt und von Branchenführern wie SIX, PwC und Julius Bär unterstützt wird.
Dufourstrasse 43
8008 Zurich
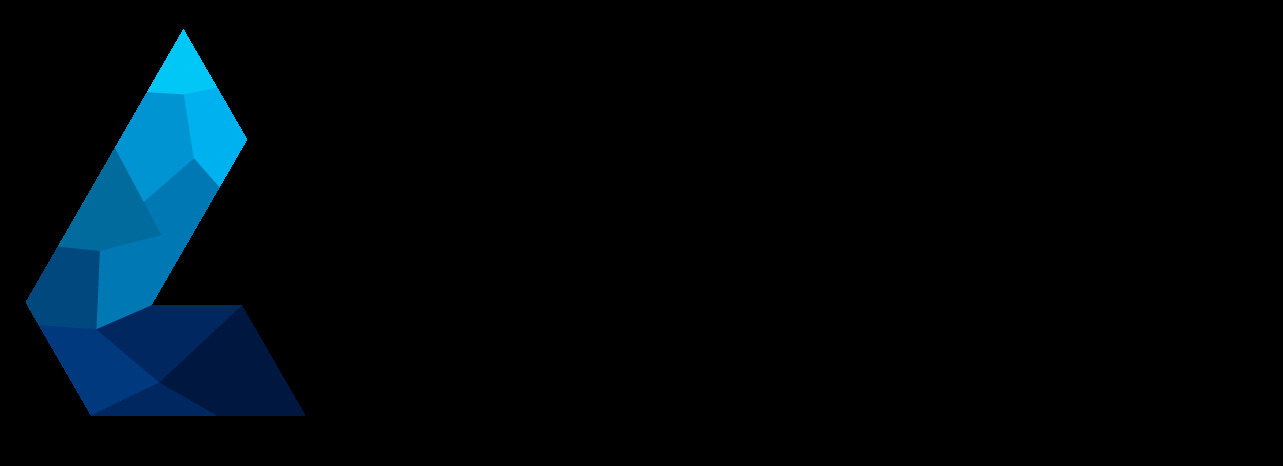
Dieses Video kommt von YouTube
Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.
Voices
Was bedeutet für Gerrit Sindermann eigentlich Innovation? Das haben wir den Präsidenten des Green Fintech Network gefragt.
Dieses Video kommt von YouTube
Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.
Voices
Jannis Fischer und Max Ahnen sind Co-Founder von Positrigo und fest im Medtech-Ökosystem verwurzelt. Wir haben sie gefragt, wie sie die Gesundheitsversorgung verbessern wollen und wie funktionelle Probleme im Gehirn früher erkannt werden sollen.
Dieses Video kommt von YouTube
Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.
Voices
Aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts sind die Rahmenbedingungen von KI-Technologien für Unternehmen, Forschung und Verwaltung oftmals unklar. Deshalb hat die Standortförderung des Kantons Zürich gemeinsam mit Partner aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft die «Innovation-Sandbox» lanciert.
Dabei handelt es sich um eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Indem die Verwaltung und teilnehmende Organisationen eng an regulatorische Fragestellungen arbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen, soll verantwortungsvolle Innovation gefördert werden. Wie dies genau aussehen kann, zeigt das Video mit Ronovatec und Lonomy, welche autonome Landwirtschaftssysteme entwickeln.
Studien
Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über rechtliche Aspekte bei der Implementierung von KI-Anwendungen. Das Dokument wurde basierend auf einem konkreten Anwendungsfall erarbeitet, bei dem Schüler:innen mit einem Smartphone-Scan handschriftlich ausgefüllte Aufgaben automatisiert korrigierten. Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf den Rechtsgrundlagen einer öffentlichen Schule im Kanton Zürich. Die Rechtslage in anderen Kantonen ist vergleichbar, die Bestimmungen werden allerdings unterschiedlich angewendet. Der Leitfaden richtet sich vor allem an Anbieter, kann aber auch Schulverantwortlichen aufschlussreiche Erkenntnisse bieten.

Dieses Video kommt von YouTube
Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.
Aktuelles
An der hybriden Fachtagung „SVSM Dialog Wirtschaftsförderung“ trafen sich in Olten Standort- und Wirtschaftsförderer aus der ganzen Schweiz. Anlass waren einerseits der fachliche Austausch und das Networking, andererseits die Verleihung der alljährlichen SVSM Awards. Diese Auszeichnungen werden seit 2007 von der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement SVSM, dem Dachverband der Schweizer Wirtschafts- und Standortförderungen, vergeben. Der Dachverband zeichnet damit zielgerichtete, effektive und innovative Projekte aus dem Standortmarketing, der Standortentwicklung und der Wirtschaftsförderung aus.
12 Bewerbungen, fünf Nominierte, zwei Awards
Für die diesjährigen Awards gingen 12 Bewerbungen aus der ganzen Schweiz ein. Eine Fach-Jury hat diese anhand festgelegter Kriterien bewertet und fünf Projekte für die Awards 2023 nominiert:
Mit Spannung erwarteten die Teilnehmenden in Olten die Ankündigung von Jury-Präsidentin und SVSM-Vorstandsmitglied Katharina Hopp, welches der nominierten Projekte tatsächlich einen Award in Empfang nehmen darf. „Die Entscheidung ist der Jury auch dieses Jahr nicht leichtgefallen“, schickte Hopp vorab. Bereits eine Nomination für den Award sei eine Auszeichnung und eine Anerkennung. Die begehrten Trophäen durften schliesslich Raphael von Thiessen von der Standortförderung Kanton Zürich und Sabrina Honegger von der Standortförderung Zürioberland entgegennehmen.
Award für Innovation-Sandbox Künstliche Intelligenz
Das Projekt „Innovation-Sandbox Künstliche Intelligenz“ der Standortförderung Kanton Zürich ist eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Die Sandbox soll verantwortungsvolle Innovation fördern, indem die Verwaltung und teilnehmende Organisationen eng an regulatorischen Fragestellungen arbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen. Jury-Präsidentin Katharina Hopp lobte bei der Award-Verleihung den klaren strategischen Ansatz und betonte, dass Projekte wie die Sandbox dringend nötig seien, hinke die Seite 2/2 Schweiz im internationalen Vergleich gerade im Bereich des regulatorischen Aspekts im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz deutlich hinterher. Auch die Tatsache, dass sich eine kantonale Stelle mit Unternehmen vernetzt, um gemeinsam den Hightech-Standort Schweiz zu fördern, halte die Jury für bemerkenswert.
Award für Plattform „Echt regional“
Der zweite Award ging an die Standortförderung Zürioberland für ihr Projekt „Echt regional“. Dabei handelt es sich um ein IT-System zur einfachen Zertifizierung von Regionalprodukten. Diese war bis anhin mit sehr viel Aufwand verbunden, was einige Produzenten von der Zertifizierung abgehalten hatte. Die neue Plattform, der sich bereits mehrere Regionalmarken angeschlossen haben, vereinfacht den Prozess und lässt sich beliebig erweitern. „Die Standortförderung Zürioberland hat zwar die Initiative ergriffen, aber keine Insellösung geschaffen, sondern eine zukunftsweisende Plattform mit viel Potenzial“, so Jury-Präsidentin Hopp an der Verleihung. Die Stärken der Schweizer Regionalprodukte würden mit diesem digitalen Showcase in den Fokus gerückt.
Sonja Wollkopf Walt ist Standortmanagerin des Jahres
Anlässlich der Verleihung der SVSM Awards zeichnet der Dachverband jedes Jahr auch eine verdiente Persönlichkeit als Standortmanager/in des Jahres aus. Nachdem in den vergangenen Jahren beispielsweise Christoph Lang, Samih Sawiris oder Bruno Marazzi die Ehrung entgegennehmen durfte, entschied sich die Jury dieses Jahr für eine Ehrung in den eigenen Reihen: Sonja Wollkopf Walt, Managing Director der Greater Zurich Area, durfte in Olten die Auszeichnung als Standortmanagerin des Jahres 2023 entgegennehmen. Botschafter Eric Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO und Jury-Mitglied der SVSM Awards, bezeichnete Wollkopf Walt in seiner Laudatio als „Pionierin und Inspiration für die nationale Standortpromotion“. Sie habe die Greater Zurich Area in schwierigen Zeiten neu positioniert und dank eines neuen Ansatzes – weg von der Geografie, hin zur Vermarktung von Ökosystemen, die keine Kantonsgrenzen kennen – Wachstum ermöglicht. „Vor einigen Jahren hast du in einem Interview auf die Frage nach deiner Laufbahnplanung geantwortet, dass du international arbeiten und etwas bewegen willst. Dies ist dir gelungen: Deine grossen Leistungen und Erfolge sind breit anerkannt – die heutige Auszeichnung zeugt davon.“
Support

Aktuelles
Forschende der Universität Zürich (UZH) beteiligen sich an dem europäischen Projekt Happy Mums, das unter der Leitung der Universität Mailand geführt wird. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, nehmen von Seiten der UZH die Forschungsgruppen des Phamakologen Urs Meyer und der Pharmakologin Juliet Richetto sowie die Gruppe der Neuro-Epigenetikerin Isabel Mansuy teil. Insgesamt beteiligen sich an dem Horizon-Europe-Projekt 17 Universitäten und Organisationen.
Gegenstand der umfassenden Studie ist nicht nur, manifeste Depressionen von Stimmungsschwankungen in der Schwangerschaft unterscheiden zu können. Es sollen auch Behandlungsmethoden gefunden werden, die das Wohl depressiver werdender Mütter bessern, ohne dem werdenden Leben zu schaden. Bislang gibt es zu geringe Erkenntnisse darüber, wie sich Substanzen wie Antidepressiva auf den Fötus auswirken. Das Projekt Happy Mums soll dazu beitragen, biologische und mikrobiologische Prozesse, die in der Schwangerschaft ablaufen, ebenso zu erkunden wie psychische Prozesse während dieser Zeit.
„Damit wir diese komplexen Zusammenhänge aufdröseln können, kombinieren wir eine Vielzahl von Daten aus der klinischen und präklinischen Forschung“, wird Juliet Richetto, Pharmakologin an der UZH, in der Mitteilung zitiert.
Um eine grosse Datenmenge zu erhalten, begleitet Happy Mums tausend Mütter und Kinder während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Dabei werden vielzählige paraklinische Werte wie Blutwerte und Hormonspiegel ebenso erhoben wie genetische Daten. Bildgebende Verfahren ergänzen das Diagnosespektrum.
Das internationale Projekt läuft bis 2026. Von den Studienresultaten erhoffen sich die Forschenden, die psychische Gesundheit von Müttern und Kindern dauerhaft zu bessern. ce/eb

UZH-Forschendeuntersuchen biologische Ursachen und Wirkungen von Depressionen in der Schwangerschaft. Symbolbild: Cparks/Pixabay
Aktuelles
Vantage Data Centers errichtet seinen 33. Campus weltweit in Glattfelden. Das Zürich 2 genannte Rechenzentrum soll laut einer Medienmitteilung in diesem Sommer eröffnet werden. Es liegt rund 20 Kilometer von dem im Dezember 2021 in Betrieb genommenen Rechenzentrum Zürich 1 in Winterthur entfernt. Auf dem dortigen 3,7 Hektaren grossen Flaggschiff-Campus hatte das weltweit tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado und Sitzen für die EMEA-Region in Luxemburg und London die Errichtung von drei Rechenzentren mit insgesamt 40 Megawatt IT-Leistung angekündigt.
Der „hochsichere und carrierneutrale“ Campus Zürich 2 wird auf 21'000 Quadratmetern 24 Megawatt IT-Kapazität bereitstellen. Zur Kundschaft von Vantage zählen sogenannte Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Grossunternehmen.
Den Angaben zufolge wird Zürich 2 über „branchenweit führende Kennzahlen“ für die Verbrauchseffektivität von Strom und Wasser verfügen. Die Abwärme soll mittels Wärmepumpen zur Klimatisierung der Büros und zur Verringerung des externen Energieverbrauchs verwendet werden. Ausserdem werde ein nahegelegenes Hotel und Seminarzentrum damit versorgt.
Zudem sei eine Regenwasserversickerung und ein begrüntes Dach vorgesehen. Die Holzfassade soll sich harmonisch in das Erscheinungsbild der Gemeinde einfügen. Vantage wird eigenen Angaben zufolge während der Hauptbauzeit etwa 400 Personen beschäftigen und etwa 25 Dauerarbeitsplätze für den Betrieb des Rechenzentrums schaffen. ce/mm

Vantage Data Centers investiert mehr als 370 Millionen Franken in sein zweites Schweizer Hyperscale-Rechenzentrum. Bild: Business Wire
Events

Events

Aktuelles
Chris Rowe aus Zürich und Will Lahaise aus London haben eine Personalberatung der nächsten Generation gegründet. Ihr Unternehmen pltfrm soll die Branche für die Vermittlung von Führungskräften neu definieren. Dazu setzen der ehemalige EMEA-Chef einer globalen Executive Search Firma und der ehemalige Leiter von UBS Recruiting neben menschlichen Kenntnissen und Einschätzungen auch Künstliche Intelligenz ein.
„Mit dem Einsatz herkömmlicher Auswahlverfahren findet man konventionelle Führungskräfte“, wird Rowe in einer entsprechenden Mitteilung von pltfrm zitiert. Dieser Ansatz sei „für viele Unternehmen nicht mehr zeitgemäss“. Pltfrm baut in seine Auswahlverfahren eine quantitative Bewertung von Inclusive Leadership und Digital Mindset ein.
„Diversität ist heute entscheidend“, meint Rowe. „Interessanterweise waren die ersten vier globalen Führungskräfte, welche pltfrm vermittelt hat, alle weiblich.“ Für den Personalexperten stellt Inklusion den „Schlüssel zu nachhaltiger Diversität“ dar. Dabei reiche eine einzelne Führungskraft mit diversem Hintergrund nicht aus. „Wir helfen unseren Kunden, vorherzusagen, welcher Kandidat oder welche Kandidatin am besten geeignet ist, diverse Teams aufzubauen“, so Rowe.
Das Büro von pltfrm in Zürich wird von Rowe geleitet, der zweite Standort in London untersteht der Leitung von Lahaise. Der innovative Ansatz von pltfrm finde auch bei grossen Unternehmen Zustimmung, heisst es in der Mitteilung. Ihr zufolge bekommt pltfrm bereits zunehmend Mandate für C-Level-Positionen. ce/hs

Will Lahaise (links) und Chris Rowe, die Gründer von pltrm. Bild: zVg/pltfrm
Events

Inno-Hubs
Bei dieCuisine dreht sich alles um zukunftsfähige Ernährung. Wir vermieten eine professionelle Küche und Räume für Events, Workshops und Seminare. Bei uns könnt ihr euch bekochen lassen oder euer Essen angeleitet von unserem Küchenteam gleich selbst zubereiten und nebenbei wichtige Zusammenhänge erfahren. Wir veranstalten Kochworkshops und engagieren uns in verschiedenen Projekten für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem. Weil Essen für uns Kultur und Gemeinschaft ist, öffnen wir an gewissen Tagen unsere Küche für alle Menschen mit Lust auf ein soziales Engagement.
Aktuelle Projekte: GastroFutura, FoodSave Market, SocialCuisine, Kantine mit Zukunft
Geerenweg 23a
8048 Zürich-Altstetten

Inno-Hubs
Das ZHAW Proof of Concept Lab (PoC-Lab) ist ein kollaborativer Innovation und Maker Space, in welchem Unternehmen, Start-ups, Hochschulinstitute und Studierende gemeinsam neue Geschäftsmodelle, Produktinnovationen und Innovationsmethoden entwickeln.
ZHAW Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung, Lagerplatz 22
Lagerplatz 24
8400 Winterthur

Inno-Hubs
Digital Winterthur ist eine Organisation, die sich auf die Förderung von Digitalisierung, Technologie und Innovation in der Region Winterthur konzentriert. Durch die Organisation von regelmässigen Veranstaltungen, Projekten und Partnerschaften schafft Digital Winterthur eine Plattform für den Austausch von Ideen, Wissen und Erfahrungen im digitalen Bereich. Die Organisation bringt Mitglieder, Experten und die breite Bevölkerung von Winterthur zusammen, um die digitale Entwicklung in der Stadt voranzutreiben. Dabei liegt der Fokus auf der Schaffung eines Innovationshubs, der die Zusammenarbeit fördert und dazu beiträgt, Winterthur als einen Ort für fortschrittliche digitale Technologien zu positionieren. Digital Winterthur könnte auch eine Rolle bei der Integration von Technologien in verschiedenen Bereichen spielen, von Wirtschaft und Bildung bis hin zu Umwelt- und Stadtentwicklung.
Klosterstrasse 34
8406 Winterthur

Entdecke alle Player im Bereich Innovationen im Kanton Zürich auf unserer Innovation Zurich Map